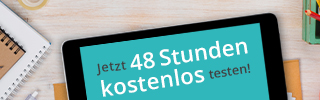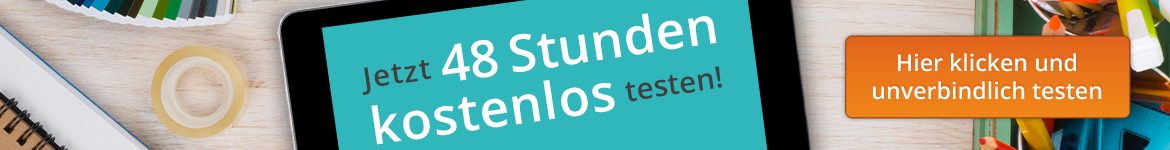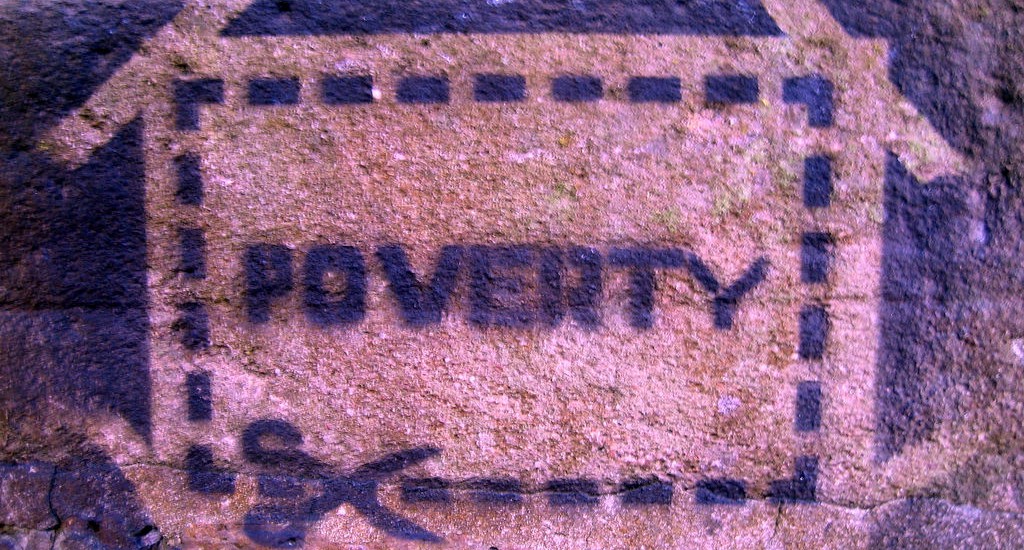
Am 10. Dezember, dem Todestag von Alfred Nobel, verleiht die Nobelstiftung in Stockholm und Oslo die Nobelpreise. Die Gewinner der jährlichen Preisvergabe verkündete sie bereits vor einigen Tagen. Wir stellen euch die Preisträger vor und beginnen mit dem Friedensnobelpreis und dem Nobelpreis für Wirtschaft.
Friedensnobelpreis
Der Nobelpreis, der die größte mediale Aufmerksamkeit genießt, ist der Friedensnobelpreis. Er wird als einziger in Oslo verliehen. Zur Riege der nicht immer unumstrittenen Preisträger gesellt sich dieses Jahr das „Quartett für den nationalen Dialog“ Tunesiens. Das Quartett setzt sich aus dem Gewerkschaftsverband (UGTT), dem Arbeitgeberverband (UTICA), der Menschenrechtsliga (LTDM) und der Anwaltskammer Tunesiens zusammen.
Zum Hintergrund: Im Jahr 2011 wurde das autoritäre Regime Ben Alis im Zuge des Arabischen Frühlings gestürzt. In der Folge der sogenannten Jasminrevolution hatte das Land mit verschiedenen Problemen zu kämpfen. Die Wirtschaft des Landes lag am Boden und die Arbeitslosigkeit war sehr hoch, wovon vor allem die jüngere Generation betroffen war. Obendrein war die soziale Situation aufgrund von Korruption, Vetternwirtschaft und Terrorismus angespannt. Hinzu kam der Frust über die wirtschaftliche Lage und das neue politische System.
Um die Situation im Land nicht in die Anarchie entgleiten zu lassen, bemühte sich das 2013 gegründete Quartett um Vermittlung und Kommunikation. Zusätzlich war es maßgeblich an der Ausarbeitung der neuen tunesischen Verfassung beteiligt.
Das Quartett schaffte es, den Konflikt zwischen Islamisten und liberalen Kräften zu unterbinden. Die 2011 gewählte Ennahda-Partei trat zurück und ermöglichte freie Wahlen im Jahr 2014. Die Stimmung im Land besserte sich und das konstitutionelle Regierungssystem bestand seine Generalprobe.
Nobelpreis für Wirtschaft
Der Nobelpreis für Wirtschaft ist kein von Alfred Nobel gestifteter Preis, sondern wird seit 1968 von der schwedischen Reichsbank vergeben. Der offizielle Titel des Preises lautet „Preis der schwedischen Reichsbank für Wirtschaftswissenschaften zum Andenken an Alfred Nobel“.
Dieses Jahr erhielt den Preis der britisch-amerikanische Wirtschaftswissenschaftler Angus Deaton. Er erforscht seit 30 Jahren den Zusammenhang zwischen Konsum, Armut und Wohlfahrt. Zu seinen wichtigsten Erkenntnissen zählt, dass Geld nur zu einem gewissen Grad glücklich macht. Unendlich viel Reichtum bedeutet nicht unendlich viel Zufriedenheit.
Zudem kritisiert er das bestehende System der Entwicklungshilfe. Er lehnt sie als solche nicht ab, argumentiert aber, dass sie nicht an Bedingungen geknüpft ist. Sie hemme die Entwicklung lokaler staatlicher Strukturen und mache zumeist mehr als 50 % des Gesamthaushaltes eines Entwicklungslandes aus. Wohin die Gelder letztlich fließen, wird weder von den Geldgebern noch innerhalb des jeweiligen Landes durch eine unabhängige Kontrollinstanz überwacht. Somit können die in guter Absicht gezahlten Gelder schnell in korrupten Systemen versickern.
Nach Deaton sollte nicht das wirtschaftliche Wachstum der Entwicklungsländer im Vordergrund der Unterstützungsleistung stehen. Das heißt, dass weniger Handelsverträge zwischen reichen und armen Staaten abgeschlossen werden sollten.
Außerdem plädiert Deaton für eine Reduzierung der Hilfszahlungen an arme Länder. Stattdessen sollten die Gesundheitssysteme der einzelnen Länder verbessert werden. Zusätzlich sollten die reichen Länder den ärmeren einen kostenfreien Technologietransfer ermöglichen. Durch beide Maßnahmen würden die entwickelten Staaten den armen Ländern effektive Hilfe zur Selbsthilfe leisten.