Im Zuge der Gleichstellung der Geschlechter lautet eine Forderung, Jungs und Mädchen getrennt zu unterrichten. Mädchen erreichen bessere Noten und höhere Abschlüsse als Jungs, sodass eine Trennung nach Geschlecht in der Schule als Lösung des Problems erscheint.
Doch wie sinnvoll ist es, Kinder separat zu unterrichten?
Pro: Jungs und Mädchen getrennt unterrichten
Lehrpläne sind geschlechterorientiert und schreiben Mädchen und Jungs soziale Rollen zu, die auf Stereotypen aufbauen. Die Kinder in unterschiedlichen Klassen getrennt voneinander zu unterrichten, kann dieses Problem beseitigen.
Durch die Abwesenheit des jeweils anderen Geschlechts zeigen sich Mädchen und Jungen entgegen den ihnen zugeschriebenen Rollen. Dieses Ablegen der „Maske“ führt dazu, dass sich die Kinder freier fühlen und sich mehr zutrauen.
In Untersuchungen hat sich gezeigt, dass Jungs in separierten Klassen aktiver am Unterricht der Geisteswissenschaften teilnahmen. Bei Mädchen zeigte sich dieses Bild in den Naturwissenschaften.
Ein weiterer Vorteil des getrennten Unterrichts ist, dass Jungs und Mädchen ihr Selbstbewusstsein in homogenen Gruppen besser entfalten. Das liegt daran, dass die Reaktionen des Umfelds anders sind als in heterogenen Klassen.
Mädchen tragen etwas zum Unterricht bei, da sie keine spöttischen Kommentare der Jungs befürchten. Jungs wiederum legen ihre „Coolness“ ab und beteiligen sich produktiv am Unterricht, anstatt zu stören.
Kontra: Jungs und Mädchen nicht getrennt unterrichten
Empirisch ist nicht erwiesen, dass getrennter Unterricht zu besseren Noten und Abschlüssen führt. Vielmehr besteht die Gefahr, dass die individuelle Förderung einzelner Schüler nicht erfolgt, weil die Geschlechterrolle alles andere überdeckt.
Die Begabung eines Mädchens zum Beispiel im Fach Deutsch könnte nicht auffallen, da sich der Unterricht auf die Förderung in den Naturwissenschaften fokussiert.
Der Unterricht erfolgt zwar getrennt, ist aber weiterhin an Geschlechterstereotypen ausgerichtet. Mädchen beispielsweise basteln und erschließen sich Inhalte in Gruppenarbeit, während Jungs Frontalunterricht erhalten.
Anstatt die Kinder frei wählen zu lassen, welcher Unterrichtstyp ihnen eher zusagt, finden sie sich weiterhin in Schubladen wieder.
In gemischten Klassen sind Jungs und Mädchen insgesamt ausgeglichener und sie üben das soziale Miteinander der Geschlechter. Später im Leben, zum Beispiel bei der Arbeit, treffen sie auf gemischte Gruppen. Dann ist es gut zu wissen, wie soziale Interaktion zwischen den Geschlechtern funktioniert.
Eine Aufsplitterung in Geschlechtergruppen bewirkt zudem, dass sich Mädchen und Jungen (noch) stärker in die ihnen bereits von der Gesellschaft zugeschriebenen Rollen fügen. Das heißt, sie nutzen Stereotypen, um sich vermehrt vom anderen Geschlecht abzugrenzen und den Zusammenhalt in ihrer homogenen Gruppe zu stärken.
Das Problem liegt nicht in den Schulen, sondern in der Gesellschaft, die den Geschlechtern Rollen zuschreibt. Diese kommen schon in Kindertagesstätten zum Tragen und verfestigen nachhaltig die Stereotypen.
Kinder nehmen diese Zuschreibungen an, um Orientierung zu gewinnen und ihre eigene Unsicherheit zu überwinden. Eine von Beginn an vom Geschlecht losgelöste Lernumgebung wäre somit deutlich effektiver, als später in der Schule zu versuchen, die vorherigen Fehler auszubügeln.
Fazit
Ist getrennter Unterricht für Mädchen und Jungs also sinnvoll? Die Idee ist gut, sollte aber ihre Fokussierung auf ein Geschlecht verlieren. Vielmehr sollte sie sich auf alle Geschlechter beziehen und die individuelle Förderung der Kinder in den Mittelpunkt rücken.
In Rücksprache mit Schülern und Eltern können die Schulen erproben, welcher Ansatz für alle am besten funktioniert.
Gerade durch die Loslösung von den geschlechtsspezifischen Ansätzen gelingt Geschlechtergerechtigkeit. Denn der Versuch ist nicht von Beginn an einer eingeschränkten Sichtweise unterworfen und kann damit gewinnbringend wirken.

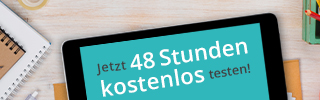






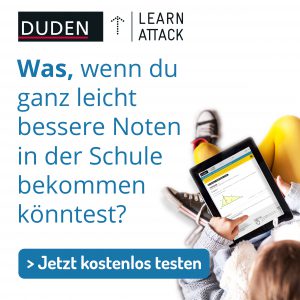
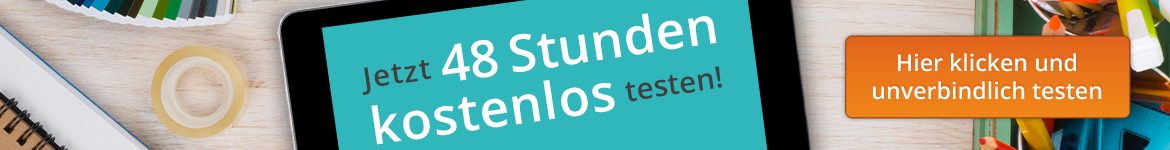
Kommentare